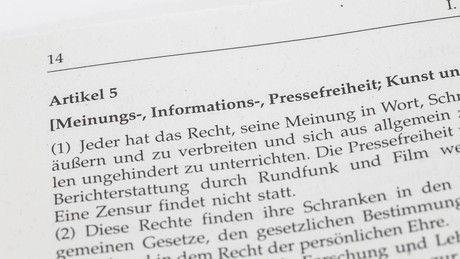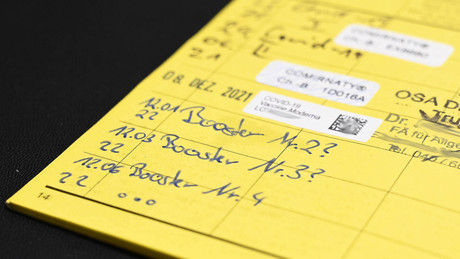Wegen "falscher Maskenatteste": Diplompsychologin zu hoher Geldstrafe verurteilt

Von Roberto Geier
Vergangene Woche fand der Prozess gegen die Diplompsychologin Magdalena Zielinski vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt statt. Gegen Zielinski wurde 2021 wegen des Vorwurfs fälschlich ausgestellter Maskenatteste Strafanzeige gestellt. In der Folge wurde ihre Praxis durchsucht. Zwei Verhandlungstage setzte der Richter an. Der Verhandlungstermin am vergangenen Mittwoch begann um 13 Uhr. Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf den Schilderungen einer Prozessbeobachterin.
Doppelte Durchsuchung von Prozessbeobachtern
Um 12:30 Uhr, eine halbe Stunde vor Prozessbeginn, standen noch rund 20 Personen, die als Prozessbeobachter gekommen waren, vor dem Eingang des Amtsgerichts. Man musste sich in eine Schlange stellen, und es wurden immer drei Personen gleichzeitig in das Amtsgericht hereingelassen. Vor der Schleuse mussten die Taschen geleert werden, man wurde von den Justizbeamten abgetastet, erst dann durfte man weiter in die Aula. Der Prozess fand in Sitzungssaal III statt. Vor dem Sitzungssaal standen mehrere Tische und eine Absperrung. Erneut wurde man von Justizbeamten durchsucht, musste unter Umständen Gürtel und Schmuck ablegen und seine Taschen abgeben. Die Gegenstände wurden in Postboxen verwahrt, für die man eine Nummer erhielt. Die Justizbeamten sichteten zudem die Personalausweise der Besucher und fertigten Kopien an.
Manche der Besucher schimpften über die Kontrollen. Doch wer als Prozessbeobachter in den Saal wollte, musste sie über sich ergehen lassen. Im Saal gab es Platz für 22 Besucher. Zu wenig, denn vor dem Saal warteten noch weitere Personen, die nur in den Saal konnten, wenn ihn jemand vorher verließ. Ein Herr wollte sich beschweren, dass der Saal zu klein war, um dem Interesse der Öffentlichkeit ausreichend nachzukommen. Die Justizbeamten teilten ihm mit, wo er sich beschweren könnte. Nach der zweiten Pause verließ jemand den Saal, und so konnte ein Prozessbeobachter nachrücken.

Das Gericht
Im Saal befand sich der Staatsanwalt, zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit einer Sachverständigen an seiner Seite, die psychologische Psychotherapeutin ist. Gegenüber saßen die Angeklagte und ihre zwei Anwälte, der Strafverteidiger Dirk Sattelmaier und die Medizinrechtlerin Beate Bahner. Der Richter schien noch recht jung, vielleicht Anfang 30. Er trat auch jugendhaft auf, gebrauchte teils eine sehr lässige Sprache und schien sich über Blickkontakt immer wieder gegenüber dem Staatsanwalt rückzuversichern. Zwischendurch versuchte der Richter, sich über Drohungen gegenüber den Prozessbeobachtern Autorität zu verschaffen. Als es einmal zu Gelächter kam, drohte der Richter, den Saal zu räumen und für alle Prozessbeobachter Ordnungsgelder zu verhängen. Die Justizbeamten waren schon bereit, die Drohung umzusetzen, als der Richter sie wieder zurücknahm und stattdessen eine Verwarnung aussprach. Eine Frau wurde dennoch später für das Sprechen aus dem Saal geführt und musste ihre Personalien angeben.
Der erste Prozesstag
Während für die Verhandlungstage eigentlich mehrere Dutzend Zeugen vorgesehen waren, erschienen am Ende nur zwölf. Rechtsanwalt Sattelmaier wies darauf hin, dass die große Anzahl an Zeugen in zwei Prozesstagen kaum zu bewerkstelligen sei. Aus gesundheitlichen Gründen beantragte er zudem, den Prozess auf nach Ostern zu verschieben. Der Richter lehnte beides ab. Es entstand der Eindruck, dass er den Prozess möglichst schnell abschließen wollte. Die aufgerufenen Zeugen wurden belehrt, dass sie nicht verpflichtet seien auszusagen, aber die Wahrheit sagen müssten.
Eine Zeugin sagte aus, dass sie seit ihrer Jugend ein Lungenleiden habe und daher Schwierigkeiten beim Atmen habe. Als im Zuge der Pandemie-Politik im öffentlichen Raum die Pflicht zum Tragen einer Maske durchgesetzt wurde, habe sie sich an Ärzte gewandt, auch an einen Lungenarzt, um ein Attest zu erhalten, das sie vom Tragen einer Maske befreite. Die Ärzte waren jedoch nicht bereit, ihr ein solches Attest auszustellen. Die Angeklagte stellte ihr ein solches Attest aus.
Die Sachverständige sagte zu dem Attest, dass die Angeklagte die Patienten an einen Arzt verweisen hätte müssen, um eine Diagnose festzustellen. Bei allen Attesten bemängelte die Sachverständige, dass aus den Attesten nicht hervorging, wann und wie die Patienten mit der Angeklagten in Kontakt getreten seien und welche Symptome beim Tragen der Maske auftreten würden und aufgrund welcher körperlichen und psychischen Erkrankungen. Krankheitsbilder anzugeben, die unabhängig vom Tragen der Maske vorliegen, reichten laut der Sachverständigen nicht aus.
Eine weitere geladene Zeugin hatte bereits ein Verfahren wegen des Vorwurfs der Verwendung eines falschen Attests gehabt, in dem sie freigesprochen wurde, und wollte zum Verfahren der Angeklagten zunächst keine Aussage machen. Sie äußerte sich dann aber doch, brach ihre Aussagen aber wieder ab, da das Ausfragen durch den Richter sie zu stark belastete. Sie sagte, der Richter solle sich ihre Prozessakte zusenden lassen. Ihre Krankengeschichte, zu der sie befragt wurde, wollte sie nicht vor Unbekannten offenlegen.
Zum Ende des Prozesstages überlegte das Gericht, wie es am nächsten Prozesstag weitergehen würde. Die Verteidigung forderte erneut mehr Prozesstage. Der Richter entgegnete, dass man den Prozess schnell abschließen könne, wenn auch am zweiten Tag so wenig Zeugen aussagten wie am ersten. Die Beweisaufnahme war noch nicht abgeschlossen, doch der Staatsanwalt stellte in den Raum, dass er für die Angeklagte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren fordern würde sowie den Entzug des Approbation und ein Berufsverbot. Der Staatsanwalt sprach hier die Angeklagte direkt an und schlug ihr vor, das Verfahren abzukürzen. Er bot eine Geldstrafe an, wenn sie gestehen würde, dass ihre Atteste fälschlicherweise ausgestellt worden wären, sodass man keine weiteren Zeugen anhören müsste. Vonseiten der Verteidigung gab es starke Einwände. Der erste Prozesstag dauert bis circa 18:30 Uhr.
Der zweite Prozesstag
Der zweite Prozesstag am Freitag begann um 9 Uhr. Von den zehn geladenen Zeugen erschienen erneut nicht alle. Eine der Zeugen, eine junge Frau, hatte 2020 in einem Restaurant als Kellnerin gearbeitet. Aufgrund der anstrengenden Arbeit bei gleichzeitig heißem Wetter und geltender Maskenpflicht kollabierte sie während der Arbeit. Als dies ein zweites Mal geschah, habe ihr Arbeitgeber gemeint, dass sie ein Befreiungsattest brauche. Die Frau sagte aus, dass ihr Arbeitgeber ihr ein Telefon ans Ohr gehalten habe und sie einer Frau am anderen Ende der Leitung von ihrem Zusammenbruch erzählt habe. Infolge des Gesprächs sagte ihr der Arbeitgeber, dass sie keine Maske mehr tragen müsse. Die Zeugin sagte, dass sie weder gewusst habe, mit wem sie am Telefon gesprochen habe, noch habe sie ein Attest beantragt oder von einem solchen gewusst. Insgesamt neun damalige Mitarbeiter erhielten von der Angeklagten ein Attest.
Ein weiterer Zeuge war ein 13-jähriger Junge, der mit seiner Mutter im Verhandlungssaal erschien. Der Junge war in der Schule zum ständigen Tragen einer Maske verpflichtet und musste mehrmals vorzeitig abgeholt werden, da er unter Kreislaufbeschwerden litt. Der sehr schüchterne Junge wurde gefragt, ob er mit der Angeklagten gesprochen habe, worauf der Junge antwortete, das habe seine Mutter gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war der Junge elf Jahre alt.
Die Sachverständige wandte ein, dass es die Pflicht der Angeklagten gewesen sei, mit dem Jungen selbst zu sprechen, um sich zu versichern, ob die Angaben der Mutter über ihren Sohn der Wahrheit entsprachen.
Eine weitere Zeugin war eine Frau, die sich mit ihrem Ehemann um die gemeinsame Tochter kümmerte. Während eines Studiums in Großbritannien war die Tochter krank geworden und wurde 2020 zum Pflegefall. Die Eltern waren mit der Situation überfordert und wollten nicht gezwungen sein, im Umgang mit ihrer Tochter eine Maske zu tragen. Die Zeugin schilderte ausführlich ihre Situation gegenüber der Angeklagten über die Messenger-App Telegram und bat um ein Befreiungsattest für sich und ihren Ehemann. Auch hier monierte die Sachverständige, dass die Angeklagte mit den Zeugen nicht persönlich in Kontakt getreten war.
Eine weitere Zeugin wurde extra von der Arbeitsstelle abgeholt. Der Richter rief aus dem Gerichtssaal am Arbeitsplatz der Zeugin an, sprach auch mit ihrem Vorgesetzten und drohte, dass er die Zeugin von der Polizei abholen lassen würde, wenn sie nicht im Verhandlungssaal erscheint.
Die Plädoyers
In seinem Plädoyer sagte der Staatsanwalt, es sei eindeutig, dass die Angeklagte in den zwölf Fällen, zu denen es Aussagen gab, Fehler gemacht habe. Den Einwänden der Sachverständigen schloss er sich vorbehaltlos an. Behörden müssten sich darauf verlassen können, dass Ärzte die Gründe für Atteste richtig dokumentierten, so der Staatsanwalt. In Übereinstimmung mit der Sachverständigen sei er der Meinung, dass die Angeklagte, sollte es erneut zu einer Pandemie kommen, genauso fehlerhaft handeln würde wie in der Vergangenheit. Er forderte eine Geldstrafe über 260 Tagessätze à 150 Euro (39.000 Euro) und ein zweijähriges Berufsverbot.
Das Plädoyer der Verteidigung hielt die Medizinrechtlerin Beate Bahner. Mit Blick auf die Mitarbeiter des Restaurants, die von der Angeklagten ein Attest erhalten hatten, verwies Bahner darauf, dass ein Arbeitgeber die Pflicht habe, dafür zu sorgen, dass seine Angestellten unter ordentlichen Bedingungen arbeiten. In der Gastronomie gehöre dazu, für ausreichend Sauerstoffzufuhr zu sorgen, wenn Mitarbeiter mehrere Kilometer am Tag zurücklegen müssen, teils mit schweren Tabletts und bei großer Hitze. Dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter keine Masken tragen müssten, wäre die niedrigschwelligste Hilfe vonseiten des Arbeitgebers gewesen. Zudem, sagte Bahner, sei die Angeklagte mehrmals im besagten Restaurant gewesen, wo sie sich einen Eindruck über die Arbeitsbedingungen verschaffen konnte.
Die als Zeugen gehörten Angestellten, so Bahner, hätten Angst vor einer Strafanzeige gehabt und deswegen für sich entlastende Aussagen gemacht. Das Attest der Angeklagten hätten sie hingegen gerne genutzt, eine der Zeuginnen sogar, um ohne Maske das Sportstudio besuchen zu können. Dass die besagten Zeugen Falschaussagen gemacht haben, ließe sich überprüfen, indem man den Arbeitgeber als Zeugen befragen würde.
Im Fall des Jungen, der als Zeuge ausgesagt hatte, sagte Bahner, dass es keinen Grund für die Angeklagte gegeben hätte, am Wort der Mutter des Jungen zu zweifeln. Die Mutter habe glaubhaft angegeben, dass sie sich wegen des Leidens ihres Sohnes zuerst an einen Kinderarzt gewandt habe, sie aber bereits von der Arzthelfern abgewimmelt worden sei, und zwar mit dem Verweis, dass der Kinderarzt keine Atteste ausstelle und das Problem ihres Sohnes ein psychisches sei. Erst daraufhin habe sich die Mutter an die Angeklagte gewandt. Bahner erinnerte auch daran, wie schwierig es unter den Bedingungen der Pandemie-Politik war, überhaupt einen Arzt persönlich aufzusuchen.
Zuletzt wies Bahner darauf hin, wie wenig wirksam Masken oder "Faceshields" zur Abwehr von Viren seien. Da musste der Staatsanwalt schmunzeln. Auch der Richter konnte sich während des langen Plädoyers der Verteidigung mehrmals das Grinsen nicht verkneifen. An keinem der beiden Prozesstagen trug jemand im Amtsgericht oder im Gerichtssaal eine Maske. Für die Angeklagte forderte die Verteidigung einen Freispruch.
Nach einer Pause teilte der Richter "im Namen des Volkes" mit, dass es sich bei den Attesten der Angeklagten um "Gefälligkeitsatteste" gehandelt habe. Dadurch nahm der Richter Bezug auf eine Behauptung des Staatsanwalts während des Prozesses, wonach die Angeklagte ihre Atteste Personen ausgestellt hätte, damit sie ohne Maske auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gehen könnten. In seiner Argumentation übernahm der Richter vollständig die Sicht des Staatsanwalts und der Sachverständigen. Die Fälle, in denen die Angeklagte ihre Patienten regulär untersucht hatte, ließ der Richter unter den Tisch fallen; ebenso die außergewöhnlichen Umstände, unter denen sich die Patienten vertrauensvoll an die Angeklagte gewandt hatten, und die juristischen Argumente, die die Verteidigung vorgebracht hatte. Das geforderte Strafmaß der Staatsanwaltschaft wurde auf 240 Tagessätze à 120 Euro (28.800 Euro) und kein Berufsverbot leicht abgemildert.
Fazit
Die Diplompsychologin Magdalena Zielinski arbeitete unter erschwerten Bedingungen und fügte mit ihren Attesten niemandem Schaden zu. Im Gegenteil, sie half Menschen in Not, wo andere Ärzte Hilfe verweigerten. Mittlerweile sollte jedem klar sein, dass die Pandemie-Politik in Deutschland mehr Schaden als Nutzen brachte. Die Einwände des Staatsanwalts und seiner Sachverständigen waren lebensfremd und unempathisch. Bei dem Urteil des Richters handelte es sich klar um ein politisches Urteil gegen diejenigen, die die Corona-Politik kritisch sahen und trotz drohender Strafverfahren bereit waren, die Schäden im Alltag im Einzelfall abzumildern. Auch wenn der Richter nicht das geforderte Strafmaß des Staatsanwalts in vollem Umfang anwandte, war es ein Urteil zum Nachteil einer gebildeten, mutigen Frau mit Jahrzehnte langer Erfahrung als Diplompsychologin.
Die Verhandlung am Freitag dauerte bei einer Stunde Mittagspause bis 20 Uhr. Die Schleuse am Eingang des Gerichtssaal war zu Prozessende bereits abgebaut. Sie war also eigens für diesen Prozess errichtet worden und eine Schikane der Personen, die als Prozessbeobachter angereist waren. Die Verteidigung hat bis kommenden Freitag Zeit, in Berufung oder Revision zu gehen.
Mehr zum Thema – Corona-Warn-App: Mittlerweile überflüssig oder nur im baldigen "Schlafmodus"?
RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.